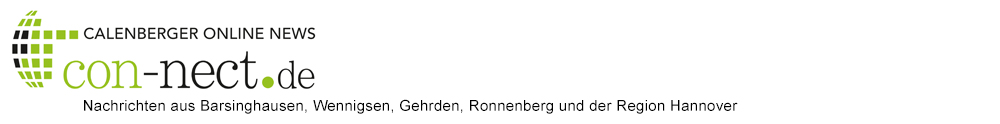Barsinghausen.
Die Goetheschule - KGS Barsinghausen hat die Ausstellung „Frieden machen“ der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) zu Gast. Mit einem interessanten und dynamischen Redebeitrag konnten Erster Stadtrat Thomas Wolf zusammen mit der zuständigen bpb-Referentin Sibel Özdemir die Ausstellung eröffnen. Zu Gast war auch eine neunte Gymnasialklasse, die die Ausstellung, welche interaktiv und spielerisch konzipiert ist, als erste Gruppe durchlief. Besonders die vielen Meinungsbilder und Interviews von beteiligten Menschen aller Seiten der Friedensarbeit, sehr jugendgerechte Filme und kurzweiligen Erläuterungen, schaffen es, das komplexe Thema jugend- und Adressanten gerecht zu vermitteln. Josefine (Schülerin 9G): „Eine tolle Ausstellung, die auch die Rechte der Frauen in Friedensprozessen beachtet.“
Sibel Özdemir betonte, dass „Friedensarbeit keine Bilder schafft“, daher immer Kriegsbilder in den Medien zu finden sind und daher die Arbeit der Friedensarbeit ziviler Konfliktbearbeiter oft verborgen bleibt.
Der Erste Stadtrat betonte die gesellschaftspolitische Dimension der schulischen Arbeit, welche die Goetheschule mit dieser Ausstellung entsprechend dem Schulprogramm zur Persönlichkeitsbildung von Schülerinnen und Schülern schafft.
Schulleiter René Ehrhardt bedanke sich bei der Arbeitsgemeinschaft“ Schule mit Courage“ und den verantwortlichen Lehrkräften Christopher Luke und Thomas Mayer für die Initiative und geleistete Zuarbeit.
Die Ausstellung ist seit Montag, 20. August, bis Freitag, 14. September, innerhalb der schulischen Arbeitszeiten für das Publikum geöffnet. Anmeldungen sind über das Sekretariat erforderlich. Es ist für die Klassen ab Jahrgang 8 konzipiert und die KGS lädt alle weiterführenden Schulen der Stadt Barsinghausen und Region zur Besichtigung ein.
Sollte man sich in die Konflikte anderer Länder und Gesellschaften einmischen? Und wenn ja, wie kann so ein Eingreifen aussehen? In welcher Situation ist es sinnvoll und wann ein Erfolg? In vielen Krisenregionen arbeitet heute neben internationalen Truppen eine Vielzahl von zivilen Fachkräften, mit dem Ziel, dauerhaften Frieden zu schaffen. Ihre Arbeit steht im Mittelpunkt dieser Ausstellung: sie moderieren Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien, setzen sich für die Gleichberechtigung von Frauen ein, organisieren die Gesundheitsversorgung, unterstützen beim Wiederaufbau der Verwaltung oder dokumentieren Menschenrechtsverletzungen. Ziel ihrer Arbeit ist es, den Frieden dauerhaft zu sichern und Bedingungen zu schaffen, damit Auseinandersetzungen in Zukunft gewaltfrei ausgetragen werden. Diese Arbeit wird gerade dann wenig wahrgenommen, wenn sie gelingt. Die Bundeszentrale für politische Bildung macht daher dieses noch junge globale Tätigkeitsfeld zum Thema einer Wanderausstellung. Die Schau, die sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler ab der neunten Klasse richtet, stellt die zentralen Instrumente und Prinzipien ziviler Friedensarbeit vor, setzt sich aber auch mit ihren Kontroversen auseinander: Soll man sich überhaupt in Konflikte anderer Länder und Gesellschaften einmischen? Wie kann ein Eingreifen gegebenenfalls aussehen? Wann ist es sinnvoll? Wie ist das Verhältnis zu militärischen Operationen? Wer definiert den Erfolg? Was ist überhaupt Frieden und kann man Frieden wirklich machen? Ausgehend von sieben grundlegenden Fragen zur zivilen Konfliktbearbeitung ermöglicht die modular angelegte Ausstellung ihren Besucherinnen und Besuchern einen Zugang zu diesem gleichzeitig komplexen wie politisch relevanten Thema. Eigens produzierte Animationsfilme veranschaulichen die zentralen Fragestellungen der zivilen Friedensarbeit. Comic-Geschichten setzen sich mit den Vor- und Nachteile ihrer Instrumente und Kriterien auseinander. Dabei bemüht sich die Ausstellung nicht nur Wissen zu vermitteln. Ihr Anspruch ist vielmehr, einen grundlegenden Zugang zu den Kernfragen dieses Themas zu eröffnen, indem sie zu Austausch und Reflexion über aktuelle politische Fragen anregt. Trotz der vermeintlichen Schwere des Themas kann deshalb dort gespielt, geraten, lauthals gestritten und ausprobiert werden. Die Wanderausstellung wurde auf Anregung des Unterausschusses für Zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages durch die Bundeszentrale für politische Bildung realisiert. Die Kuration erfolgte durch den Verein Politikmuseum e.V.